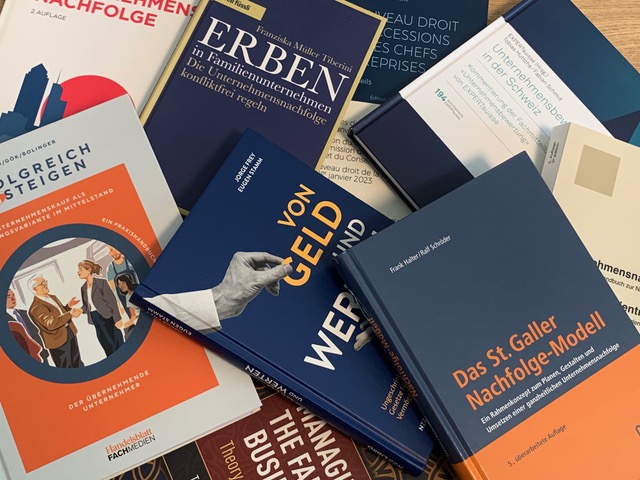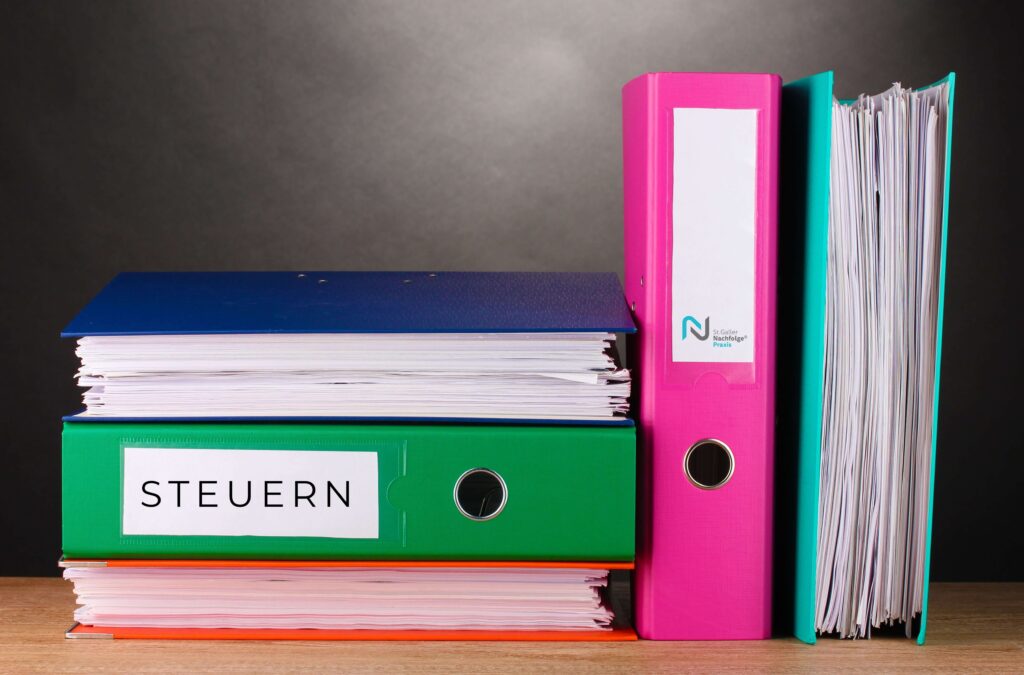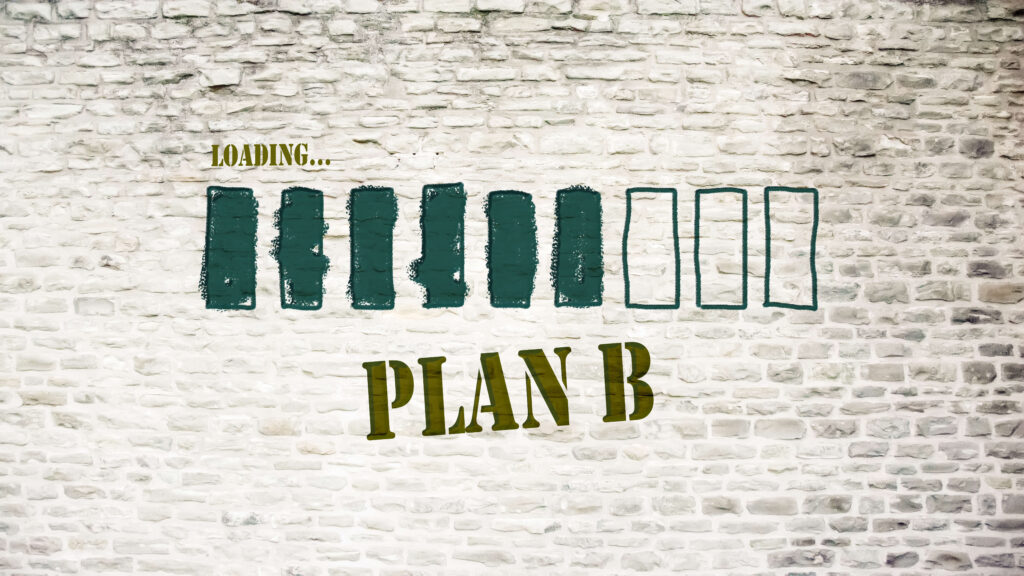Die Übergabe eines Unternehmens ist Chance und Herausforderung zugleich. Nebst dem St. Galler Nachfolge-Modell, das als Rahmenkonzept unterstützt, den Nachfolgeprozess strukturiert und gleichzeitig individuell anzugehen, hat St. Galler Nachfolge auch die Formel „Wollen x Können x Dürfen“ entwickelt. Die Formel ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf Erwartungen, Denkweisen und Standpunkte jeder Partei und sie ermöglicht, Muster zwischen den Parteien greifbarer zu machen. Damit erhöht sich die Chance, Herausforderungen erfolgreich und konstruktiv zu überwinden.
Eindimensionale Sichtweisen sind bei einem Nachfolgeprozess, der immer komplex und vielschichtig ist, wenig hilfreich und nicht zielführend – wir von St. Galler Nachfolge empfinden solche sogar als falsch. Um es plakativ zu beschreiben: es sind nicht einfach die Jungen, die nichts können oder die Alten, die nicht loslassen wollen. Oder anders formuliert: es liegt nie nur an einer Partei, wenn der Prozess stockt oder es Herausforderungen zu überwinden gilt.

Wenn die eine Generation der nächsten Generation das Unternehmen übergibt, dann bewegt man sich in einem Rahmen, in dem man interagiert und insofern auch voneinander abhängig ist. Das Verhalten von Menschen ist miteinander verknüpft, man reagiert aufeinander, es spielen Muster und Dynamiken. Bei einer Unternehmensübergabe braucht es per se immer zwei Parteien. Und damit spielen auch diese Interaktionen. Am vielschichtigsten und oft auch emotionalsten bei familieninternen Übergaben. Weil da zusätzlich auch noch zwei Sozialsysteme involviert sind, die unterschiedlich ticken: das des Unternehmens und das der Familie.
Mit der Formel „Wollen x Können x Dürfen“ hat St. Galler Nachfolge ein Hilfsmittel entwickelt, das hilft, die Ausgangslage und Perspektiven jeder Partei bewusster zu machen und den individuellen Entwicklungsprozess (siehe Abb. 1) bewusst zu gestalten. Es geht dabei darum, ob jede Partei die Fragen nach dem „Wollen-Können-Dürfen Übernehmen / Übergeben“ mit Ja beantworten kann: ja, ich will – ja, ich kann – ja, ich darf. Nur auf dieser Basis ist es möglich, den Nachfolgeprozess überhaupt anzugehen und so zu gestalten, dass er nachhaltig erfolgreich sein kann.
Was steckt nun aber hinter „wollen“, „können“ und „dürfen“ und zwar je unabhängig – aus Sicht der übergebenden Partei wie auch der übernehmenden Partei. Versuchen Sie die Fragen als Unternehmerin, als Unternehmer zu beantworten (und nicht als Vater, Mutter, Tochter oder Sohn) und dabei immer mit Sicht auf das Unternehmen und was dieses braucht, um auch in der Zukunft erfolgreich sein zu können.
Die Perspektive der übergebenden Generation – Verantwortung bewusst loslassen
Für Übergeber steht häufig die Herausforderung im Vordergrund, sich von der Verantwortung zu lösen, die sie jahrelang getragen haben. Wichtig sind hierbei drei wesentliche Aspekte:
Wollen – Emotionale Bereitschaft schaffen
Möchte ich meine Führungs- und Eigentümerrolle wirklich abgeben? Wesentliche Überlegungen dabei sind das Bedürfnis, neue Impulse im Unternehmen zuzulassen sowie der Wunsch, mehr Zeit ausserhalb der Unternehmensführung zu verbringen. Emotional bedeutet dies, die eigene Identität nicht mehr ausschliesslich mit dem Unternehmen zu verbinden und bewusst Raum für Neues zu schaffen.
Können – Die organisatorische Grundlage schaffen
Sind die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um Verantwortung ab und die Fäden aus den Händen zu geben? Die Führungsstrukturen müssen so etabliert sein, dass wesentliche Prozesse ohne direkte Beteiligung der übergebenden Generation funktionieren. Zudem sollten klare Regeln im Aktionärsbindungsvertrag die zukünftige Rolle und eventuelle Einflussnahmen regeln. Entscheidend ist auch, Klarheit zu haben, mit welchen Berechnungsmethoden ein fairer Preis für die Unternehmensanteile gefunden wird, um wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Zu diesem Faktor gehört auch, dass die private Vorsorgesituation geklärt und der neue Lebensabschnitt finanziell abgesichert ist.
Dürfen – Vertrauen und Umfeld berücksichtigen
Ist mein Umfeld mit den geplanten Schritten einverstanden, und habe ich Vertrauen in die nachfolgende Generation? Enge Bezugspersonen, Familie, Partner und Mitarbeitende sollten hinter der Entscheidung stehen. Symbolische Schritte, wie etwa eine Übergabezeremonie oder eine gemeinsame Reise für danach können das Loslassen auf emotionaler Ebene unterstützen und schaffen Klarheit und Akzeptanz in den sozialen Beziehungen.
Die Perspektive der übernehmenden Generation – Verantwortung aktiv übernehmen
Für die nachfolgende Generation bedeutet Unternehmensnachfolge oft die Herausforderung, Verantwortung anzunehmen und unternehmerisches Denken aktiv umzusetzen. Auch hier zeigt sich das „Wollen x Können x Dürfen“-Modell als wertvolles Instrument:
Wollen – Die Vision und das Engagement stärken
Will ich diese Verantwortung und habe ich eine klare Vision für das Unternehmen und für mich in dieser Rolle? Es ist entscheidend, einen starken Willen zum Gestalten und Verändern zu haben sowie die Bereitschaft, Unternehmensinteressen über persönliche Bedürfnisse zu stellen. Die Nachfolgegeneration sollte eine persönliche Mission entwickeln, die sie nachhaltig motiviert und antreibt.
Können – Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln
Bin ich fachlich und persönlich bereit? Sich bewusst zu sein, was es an Kompetenzen und Fähigkeiten braucht, um wirksam zu führen (und sich selbst treu zu bleiben) sowie die Fähigkeit, Mitarbeitende auf gemeinsame Ziele auszurichten und Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen, sind essenziell. Es ist wichtig, eigene Stärken und Entwicklungsfelder zu erkennen und persönliche Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln. Auch finanzielle und steuerliche Aspekte rund um die Eigentumsübernahme sollten klar sein. Die Fähigkeit, externe Finanzierungsmöglichkeiten effektiv zu nutzen und das finanzielle Risiko realistisch einzuschätzen, spielt dabei eine zentrale Rolle.
Dürfen – Unterstützung und Rückhalt sichern
Habe ich die Unterstützung meines Umfelds, vor allem die Unterstützung meiner Familie, mir wichtiger Bezugspersonen sowie des bisherigen Eigentümers, der bisherigen Eigentümerin? Es ist wichtig, das Vertrauen und Zutrauen der übergebenden Generation sowie der Mitarbeitenden zu spüren. Familiäre und partnerschaftliche Rahmenbedingungen sollten frühzeitig geklärt und auch in Verträgen festgehalten werden. Diese Klarheit verhindert später potenzielle Konflikte und schafft eine stabile Grundlage für die erfolgreiche Führung des Unternehmens.
Wollen x Können x Dürfen – ein logisches Ergebnis?
Wie lassen sich nun diese Überlegungen von oben in der WKD-Formel abbilden, respektive was lässt sich daraus ableiten? Die Grund-Aussage der Formel lautet: es braucht sechs Ja-Antworten, damit die Grundlage für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess gegeben ist. Ein einziges Nein reicht aus und das Ergebnis ist formalistisch gesprochen „Null“ und führt zu einem Nicht-Übergeben oder Nicht-Übernehmen und damit besteht fehlt auch die Grundlage für den Prozess der Nachfolge.

Rechnerisch kann man sich das auch so vorstellen: Jeder der drei Faktoren wird mit 0 (überhaupt nicht erfüllt / vorhanden) bis 1 (voll erfüllt / vorhanden) bewertet. Das maximal erreichbare Ergebnis ist somit 1. Wird einer der Faktoren mit 0 „nicht erfüllt“ bewertet, dann wird das Ergebnis aus mathematischer Sicht auch „0“ sein – selbst dann, wenn die anderen beiden Faktoren mit „voll erfüllt“ bewertet worden sind. Eine Nein-Antwort und damit Nuller-Bewertung kann nicht „kompensiert“ werden.
Wo stehen Sie aktuell? – So finden Sie es heraus
Um herauszufinden, wo Sie als Übergeber:in oder Nachfolger:in aktuell beim Wollen, Können und Dürfen stehen, empfiehlt sich eine systematische Selbstreflexion. Hilfreiche Fragen könnten sein:

Nutzen Sie diese Fragen für Ihre persönliche Reflexion, diskutieren Sie Ihre Antworten mit Vertrauenspersonen oder arbeiten Sie mit einer professionellen Sparringpartnerin oder einem Sparringpartner, um den Prozess der Reflexion aktiv zu unterstützen. Die Klarheit, die dadurch entsteht, bildet die beste Basis, um die Unternehmensnachfolge nachhaltig erfolgreich zu gestalten – zum Wohle und im Sinne Ihres Unternehmens und aller Beteiligten.
Auf unserer Plattform finden Sie weiterführende Unterlagen rund um den Nachfolgeprozess. Im Zusammenhang mit der WKD-Formel könnten für Sie folgende Inhalte interessant sein:
- Unser Dossier zu “KMU Nachfolge als Prozess” (Schrift 04)
- Unser Dossier zu “KMU Nachfolge und meine Vision” (Schrift 03)
- Arbeitsmittel zur Selbstreflexion: Wollen x Können x Dürfen
- Rollenklärung bei der Führungsnachfolge: Blog 20 | Weshalb die Hüte bei der Führungsnachfolge wichtig sind
- Blog 18 | Wie der Führungswechsel gut gelingt
Im Download-Center stellen wir Ihnen weitere Unterlagen und Arbeitsblätter kostenlos zur Verfügung.
Das St. Galler Nachfolge-Modell als Buch
Die Abbildungen in diesem Blogbeitrag sind dem Buch “St. Galler Nachfolge-Modell” entnommen. Es ist im Jahr 2022 in seiner 5. und überarbeiteten Auflage erschienen und kann als Hardcover (Buch) oder E‑Book gekauft werden.
Fotonachweis: Shutterstock | Abbildungen: St. Galler Nachfolge